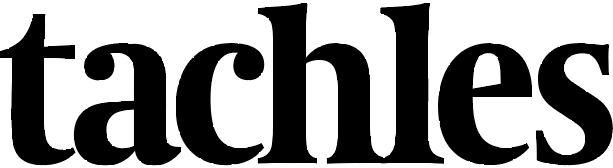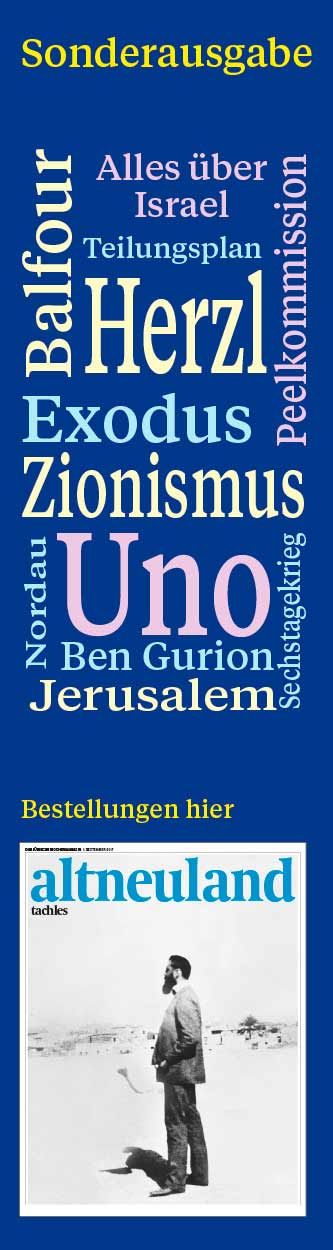Die Bedrohung jüdischer Studierender an deutschen Hochschulenseit dem 7. Oktober 2023 ist exemplarisch für die Situation in vielen Ländernwie Frankreich, Grossbritannien, den USA und sogar der Schweiz.
Das Jahr 2024 war kein Gutes für die akademische Welt, tachles berichtete regelmässig über die Eskalationen der Uni-Proteste in Europa, in den USA, kürzlich wieder über die Lausanne in der Schweiz. Gerade eben der nächste Skandal: Die Uni Leipzig lud den israelischen Historiker Benny Morris, der einen Vortrag halten sollte, wieder aus. Der Grund: Feigheit. Die Uni-Leitung führte Studentengruppen an, die sich über den angeblichen Rassismus von Morris aufgeregt hatten. Und sie erklärte, es sei zu gefährlich, Morris in die Uni zu holen. Wieder ein Sieg für aggressive Aktivisten, die sich als «propalästinensische» Unterstützer sehen und nicht begreifen wollen, dass sie in ihrem Verhalten längst autoritäre Züge angenommen haben. Wer ihnen nicht passt, darf nicht mehr zu Wort kommen. Mit der Verpflichtung des akademischen intellektuellen Milieus, sich der Diskussion zu stellen, natürlich auch kontroversen Diskursen, hat das alles nichts mehr zu tun. Aber das ist ja bekannt, spätestens seit Führungsfiguren prominenter Ivy-League-Universitäten bei einer Anhörung auf die Frage, ob sie die Forderung nach einem Genozid an Juden an ihren Hochschulen akzeptieren würden, erklärten, dies käme «auf den Kontext» an.
Drohung statt Disput
Morris hat also angeblich etwas Rassistisches in einem Interview geäussert, er hat sogar die Bombardierung des Irans und seiner Nuklearanlagen gefordert – und schon zuckt eine Universitätsführung zurück, wenn aufgebrachte Studenten mit Gewalt drohen. Dabei geht es nicht darum, den Thesen oder Gedanken eines Benny Morris kritiklos zuzustimmen, im Gegenteil. Diese jungen «Intellektuellen» hätten ihm zuhören und in ein Streitgespräch verwickeln können. Das wäre bester intellektueller Streit gewesen, Disputatio nannte man das früher.
Heute wird lieber gedroht. Mit Gewalt. Heute wird vonseiten der Universitätsleitungen – und man muss da den Plural setzen – eingeknickt. Mangel an Zivilcourage, nennt man so etwas, das Fehlen einer geistigen Haltung, die Auseinandersetzung nicht scheut.
Das ist die Atmosphäre, in der sich jüdische Studierende seit dem 7. Oktober wiederfinden. Weltweit. Über die Besetzung und Bedrohung auf amerikanischen Campus wurde in der Presse viel und ausführlich berichtet, und über die Drohungen gegenüber jüdischen Amerikanern, die sich nicht mehr an ihre Alma Mater trauten, weil sie Gewalt fürchten mussten. Auch hier inzwischen nur noch Polarisierung. Drohungen, Boykotte, Gewalt, Ausgrenzung. Juden sind unerwünscht. Von den nicht jüdischen Kommilitonen und offensichtlich auch von vielen Universitätsrektoren, die entweder selber eine antiisraelische Haltung einnehmen und entsprechende Äusserungen posten oder liken, wie etwa Geraldine Rauch, die Präsidentin der TU in Berlin, die sich später dafür entschuldigte, aber keinerlei Veranlassung sah, ihren Posten zu räumen.
Propalästinensisch oder für die Hamas
Juden sind wieder Studenten zweiter Klasse, so scheint es inzwischen an vielen Universitäten weltweit zu sein. Auch und gerade in Deutschland. Da ist es besonders schlimm vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte. An manchen Universitäten scheint das inzwischen als Teil des wissenschaftlichen Diskurses gewertet zu werden. Protest müsse erlaubt sein, war zu hören. Was dabei gerne übersehen wird: Häufig ist der «propalästinensische» Protest ein Protest für die Hamas, also die Unterstützung einer islamistischen Terrororganisation, eine Unterstützung des genozidalen Charakters des Massakers vom 7. Oktober. Es ist ein Protest gegen das Existenzrecht Israels, es ist ein Protest, der mit Begriffen um sich wirft, die juristisch noch nicht belegt sind: «Genozid», «Apartheid» und viele andere gehören zu diesen Slogans. Die Vorverurteilung Israels ist Programm.
Kampf um Recht
Jüdische Studierende fühlen sich allein gelassen. Die Konsequenzen sind teilweise erschreckend. Einige trauen sich nicht mehr auf den Campus, andere kämpfen um ihr Recht, gesehen und gehört zu werden, wieder andere versuchen, ihr Jüdischsein an der Uni zu verstecken.
So auch ein Student der FU Berlin. Im Gespräch besteht er darauf, dass weder sein Name noch sein Alter noch sein genaues Studienfach erwähnt wird, damit «niemand an Hand der Informationen herausfinden kann, wer ich bin». Nennen wir ihn also Michael. Was gesagt werden kann: Er studiert im Bereich Geisteswissenschaften. «Meine Professoren wissen nicht, dass ich Jude bin, von meinen Kommilitonen nur einige wenige», erzählt Michael. Er fürchtet Nachteile, wenn die Dozenten herausfinden würden, dass er jüdisch ist. Er misstraut ihnen vielleicht sogar noch mehr als den Studierenden. Seine Meinung zu Israel gibt er an der Universität nicht preis, er bemüht sich, so apolitisch wie nur möglich zu sein. Und er überlegt bereits, ob er Deutschland verlassen soll. «Wenn ich eines Tages Kinder habe, möchte ich nicht, dass sie in so einer Atmosphäre aufwachsen müssen», erklärt Michael. Wohin er gehen will, darüber hat er sich noch keine Gedanken gemacht. Israel? «Wenn es dort Frieden geben sollte eines Tages, warum nicht?», eine Antwort, die ein Nein bereits impliziert. Aber dann wohin? USA? «Ich habe mir konkret darüber noch keine Gedanken gemacht. Ich sehe nur, wie sich die Situation für uns Juden zunehmend verschlechtert.»
Die Liste der antiisraelischen und antisemitischen Vorkommnisse an deutschen Unis ist endlos. Als die Uni Düsseldorf eine Solidaritätsnachricht für Israel gepostet hatte, waren die Reaktionen heftig. Eine lautete: «Drecksjudenuni». An der Uni Hamburg wurden Flyer ausgelegt, die eine Ablehnung der IHRA-Definition von Antisemitismus fordern, eine Definition, die spezifische Formen des Hasses auf Israel ebenfalls als Antisemitismus beschreibt. Linksradikale Kräfte organisieren Veranstaltungen an vielen Unis, die häufig von islamischen Gruppen von aussen mit unterstützt werden, die sich als revolutionär verstehen, so etwa «Thawra», aber auch andere, wie beispielsweise die Frauenorganisation Zora, die Propaganda der Volksfront zur Befreiung Palästinas (PFLP) verbreitet. Immer wieder finden sich an Universitäten Graffiti, die Zionismus mit Faschismus gleichsetzen, Israel als «Kindermörder» und vieles mehr bezeichnen. Sie werden rasch entfernt, aber häufig werden sie wieder gesprayt. In Berlin gab es zahlreiche Hörsaalbesetzungen, es wurde gebrüllt «Zionisten raus», die Aggression richtet sich auch gegen Juden, die gar keine Israelis sind. Handynummern von jüdischen Studenten werden auf Klowände geschrieben, damit man diese einschüchtern und bedrohen kann. Der Fall von Lahav Shapira ging durch die Medien, der Student wurde ausserhalb der Uni von einem muslimischen Mitstudenten in Berlin krankenhausreif geprügelt. In Hamburg wurde eine Zuhörerin einer Ringvorlesung, die sich als proisraelisch präsentierte, geohrfeigt, in Leipzig wurde ein Student, der gegen die Besetzung seiner Uni demonstrierte, getreten. In Nordrheinwestfalen wurde Studierenden häufig der Zugang zu Räumlichkeiten verwehrt, weil sie angeblich «zionistisch» waren. Dabei spielte es keine Rolle, ob sie jüdisch waren oder nicht.
Die Humboldt-Eskalation
Einer der bekanntesten Vorfälle ist die Besetzung des Instituts für Sozialwissenschaften an der Humboldt-Universität in Berlin. Die Räume wurden zerstört, an den Wänden prangte unter anderem das rote Hamas-Dreieck, das Symbol für «Ziele», die man angreifen und vernichten soll. Auch hier soll eine Organisation von aussen unterstützend mitgewirkt haben, «Palestine Speaks», die das Massaker des 7. Oktober als «revolutionären Tag» feierte. Noam Petri, Vizepräsident der Jüdischen Studierendenunion in Deutschland, erzählte, dass ein Antrag im Studentenparlament der Uni Darmstadt, jegliche Kooperation mit Gruppen zu beenden, die mit der Hamas sympathisieren mit 99 % der Stimmen abgelehnt wurde. Die Liste könnte endlos fortgeführt werden.
Petri, ebenso wie viele andere jüdische Studenten, machen die postkoloniale Ideologie mit verantwortlich für den blanken Hass auf Israel und auf alles Jüdische. Die Singularität des Holocaust wird verleugnet, Israel fälschlicherweise als «koloniales Projekt» gebrandmarkt. Ähnliches ist in den USA, in Frankreich, in Grossbritannien an den Universitäten zu beobachten.
Im Frühjahr unterschrieben mehr als 1000 Akademiker das «Statement von Lehrenden an Berliner Unis», in dem die Räumung eines Protestcamps an der FU Berlin durch die Polizei kritisiert wurde. Darin hiess es, dass das Recht auf friedlichen Protest auch die Besetzung von Uni-Gelände miteinschliesse. Doch ist ein Protest wirklich friedlich, wenn es dabei Gruppen gibt, die jüdischen Studenten den Zutritt zu einem Hörsaal verwehrten und wenn zur Vernichtung Israels aufgerufen wird, und anderes mehr?
Rechtsfreier Raum?
Die Frage, die sich angesichts jenes «Statements» stellt, ist, inwiefern Universitäten rechtsfreie Räume sein sollen. Warum straffällige Studenten nicht entsprechend festgenommen werden dürfen. Wie so häufig «stinkt der Fisch vom Kopf». Die Verantwortlichen an den Unis haben mit mindestens drei Problemen zu kämpfen – Mangel an Fürsorgepflicht für jüdische Studierende, oftmals die eigene unreflektierte antizionistische oder antisemitische Einstellung und schliesslich häufig auch mit mangelnden Kenntnissen, wenn es um Antisemitismus und Antizionismus und natürlich die politischen Gegebenheiten des Nahen Ostens geht. Vielen fehlt obendrein das Sensorium und die Empathie für die Nöte der jüdischen Studierenden.
Michael und viele andere versuchen sich wegzuducken, um möglichst unproblematisch durch ihre Studentenjahre zu kommen. Andere zeigen Gesicht, wehren sich. Allen voran die Präsidentin der Jüdischen Studierendenunion, die 26-jährige Hanna Veiler, die inzwischen der Darling der Medien geworden ist, da sie als Aktivistin unerschrocken und mutig Klartext redet. Inzwischen haben sich auch jüdische Dozenten organisiert, um sich gemeinsam gegen die Folgen, die sie betreffen, zu wehren. Ihre Bedrohungslage ist in Teilen so akut gewesen, dass einige von ihnen zeitweise nur noch Online-Kurse anboten, da sie sich wegen der Bedrohungslage nicht mehr an ihre Hochschule wagten.
Wohlgemerkt, all das ist 2024 geschehen. Nicht etwa 1934. Einziger Lichtblick: Es gibt noch Universitätsleitungen, die sich solchen Entwicklungen entgegenstellen. Eigentlich sollte das die Normalität sein. Doch heutzutage ist das inzwischen etwas ganz Besonderes und muss positiv erwähnt werden.