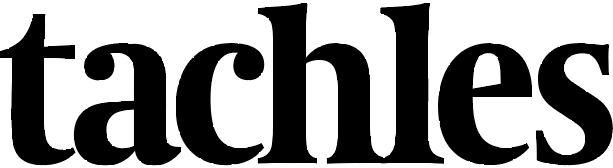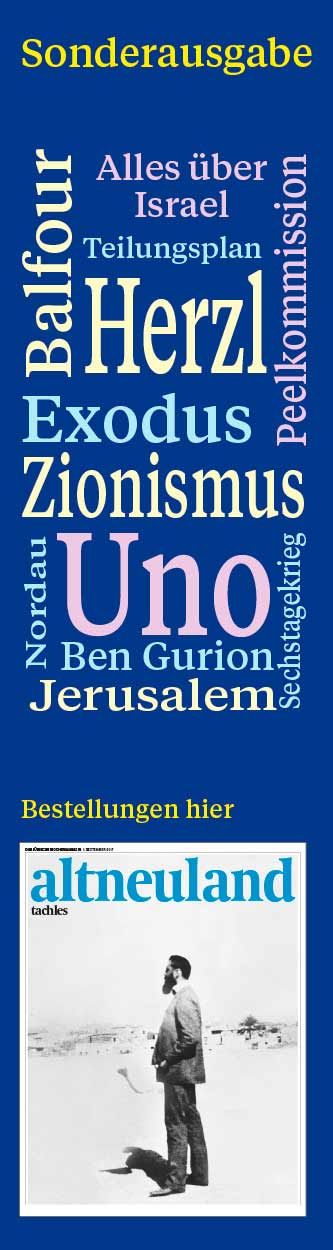Im Konzentrationslager Ravensbrück wurden Frauen nicht nur entrechtet und erniedrigt, sondern gezielt in ihrer Mutterschaft angegriffen – und sie schufen dennoch Formen des Schutzes, der Fürsorge und der Erinnerung.
Trennung von Müttern und Kindern, Zwangssterilisationen und -abtreibungen sowie Morde an Neugeborenen waren gängige Verfolgungspraktiken im Frauen-Konzentrationslager Ravensbrück. Viele überlebende Häftlinge haben ein Leben lang mit den ihnen zugefügten Traumata zu kämpfen.
Elisabeth Sommer-Lefkovits stand im November 1944 vor den Toren des Konzentrationslagers (KZ) Ravensbrück. Sie kam zusammen mit ihren beiden Söhnen in einem Massentransport aus dem slowakischen Prešov hierher. Schon seit April ist sie allein mit den Kindern. Die ganze Familie hatte einen Versuch unternommen, aus der Slowakei zu fliehen, bei dem ihr Mann in Budapest bleiben musste. Elisabeth wollte um keinen Preis zulassen, dass ihre Familie noch weiter auseinandergerissen wird. Es gelang ihr nicht. Bei der schnellen Selektion der neuen Häftlinge in Ravensbrück schickte man ihren älteren, kaum 14 Jahre alten Sohn Paul ins Männerlager und sie kam mit ihrem jüngeren Sohn ins Frauenlager.
Nationalsozialistische Mutterschaftsideologie
Paul, der schliesslich auf eigene Faust gegen die Schwierigkeiten im Männerlager ankämpfen musste, wurde später bei der «Liquidation» mit einem Decknamen getötet. Der siebenjährige Ivan blieb jedoch bis zur Befreiung bei seiner Mutter und überlebte durch ihre Fürsorge und grosses Glück den Holocaust. Der Nationalsozialismus (NS), die Staatsideologie Deutschlands von 1933 bis 1945, basierte auf traditionellen Vorstellungen über Unterschiede zwischen männlichen und weiblichen Rollen und die natürliche körperliche und geistige Unterordnung der Frau unter den Mann. Er glorifizierte die Mutterschaft und förderte eine auf die traditionelle Familie ausgerichtete Politik.
Die gegen die weiblichen Häftlinge in den Konzentrationslagern gerichteten Nazi-Praktiken standen jedoch in einem krassen Widerspruch zu diesen Prinzipien. Mütter wurden über lange Zeiträume hinweg von ihren minderjährigen Kindern isoliert, bei schwangeren Frauen wurden Zwangsabtreibungen vorgenommen, Frauen im gebärfähigen Alter zwangssterilisiert, Neugeborenen liess man nicht die geringste Pflege und Fürsorge angedeihen oder ermordete sie sogar sofort. Auch Internierungen und Mord an Kleinkindern und Jugendlichen waren an der Tagesordnung.
Das zentrale Frauen-Konzentrationslager des NS-Regimes in Ravensbrück war tagtäglich Schauplatz von Angriffen auf das innerste Wesen der Mutterschaft, und die dortigen Lebensbedingungen erreichten diesbezüglich für viele der dort inhaftierten Frauen eine bis zu diesem Zeitpunkt unvorstellbare Grausamkeit. Der Grad an Gewalt, mit dem sie in den Lagern konfrontiert wurden, nahm extreme Ausmasse an.
In den Erinnerungen ehemaliger weiblicher Häftlinge wird Mutterschaft nicht unterbewusst nur als biologische Gegebenheit verstanden, sondern als Ausdruck einer Reihe weiterer, insbesondere psychologischer oder sozialer Faktoren. Nationalität, Religionszugehörigkeit oder politische Anschauungen spielten dabei scheinbar eine wichtige Rolle. Beispielsweise finden sich in den Memoiren einiger inhaftierter polnischer oder französischer Katholikinnen Tendenzen, Parallelen zwischen sich und Figuren der christlichen Heilsgeschichte zu ziehen oder sich mit diesen zu identifizieren, etwa mit der Gottesmutter Maria.
Die linksgerichtete Avantgarde-Künstlerin Nina Jirsíková hat in ihren Skizzen des Lageralltags Mütter mit Kindern im Stil einer christlichen Pietà festgehalten und in ihren Erinnerungen die KZ-Mütter keinesfalls spöttisch als «Lagermadonnen» bezeichnet. Politische Gefangene aus der Tschechoslowakei feierten im Lager den Muttertag, einen Feiertag, der in seiner modernen Form Anfang der 1920er-Jahre dank Alice Masaryková auf dem Gebiet der Tschechoslowakei Einzug hielt und dessen Grundprinzip nicht nur die Feier der Mutter-Kind-Beziehung war, sondern auch der Mutterrechte, die in der Gesetzgebung der ersten tschechoslowakischen Republik verankert waren.
Gewalt gegen zukünftiges Leben
Die Grenze zwischen Kindheit und Erwachsensein war in der Verfolgungspraxis der Nazis nicht genau festgelegt bzw. beruhte auf rassenbiologischen Überlegungen. Beispielsweise wurden die aus politischen Gründen verfolgten Tschechen und Tschechinnen ab 16 Jahren in ein Konzentrationslager deportiert. Im Gegensatz dazu wurden Personen, die in der Nazi-Terminologie als «Asoziale» klassifiziert waren, unabhängig von ihrer Nationalität oder der sogenannten Rassenzugehörigkeit ab Frühjahr 1942 erst ab einem Alter von 18 Jahren im KZ Auschwitz inhaftiert. Bei der Deportation von Juden und Roma in Gemeinschaftstransporten machte man wiederum keinen Unterschied zwischen Erwachsenen und Kindern. Ziel dieser Rassendeportationen war die Ausrottung ganzer Volksgruppen und betraf somit Männer, Frauen (einschliesslich schwangerer Frauen) und Kinder. Auch bei Selektionen im Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau gab es hinsichtlich des Alters keine verbindliche Regelung. Die SS-Ärzte trafen Entscheidungen über Leben und Tod nach eigenem Ermessen, meist jedoch aufgrund des äusseren Erscheinungsbildes. Der entscheidende Faktor war die potenzielle Arbeitsleistung des Häftlings. Aus diesem Grund wurden Kinder unter 14 Jahren bei den Selektionen meist automatisch aussortiert.
Kinder jeden Alters
Kinder jeden Alters wurden in die Lager transportiert und es wurden auch Kinder in den Lagern geboren. Wie auch bei den Erwachsenen verfuhr man mit ihnen prinzipiell unter den Gesichtspunkten von Rasse oder Nationalität, auch die Staatsangehörigkeit hat möglicherweise eine gewisse Rolle gespielt, wenn sie beispielsweise aus neutralen oder gar mit Deutschland befreundeten Staaten kamen. Jedoch unterschieden sich die Praktiken in den einzelnen Konzentrationslagern.
Mindestens 881 Kinder im Alter von zwei bis 16 Jahren wurden in den Jahren 1939 bis 1942 nach Ravensbrück gebracht. Bereits im Jahr 1939 kamen mit den Transporten von Sinti und Roma aus dem österreichischen Burgenland 14- bis 16-jährige Mädchen an. Ab 1943/1944 waren viele jüdische Mütter mit Kindern ab zwei Jahren zu sehen, die türkische, ungarische, rumänische, portugiesische und spanische Staatsangehörige waren. Auch minderjährige Russinnen, Ukrainerinnen und Polinnen im Alter von 16 Jahren befanden sich im Lager, teils auch jüngere Mädchen, die zuvor zur Zwangsarbeit nach Deutschland geschickt worden waren. Viele Kinder kamen 1944 mit den sogenannten Evakuierungstransporten aus Auschwitz nach Ravensbrück, insbesondere aus dem Frauen- und dem «Zigeunerlager», des Weiteren auch mit Transporten von verhafteten Aufständischen aus Warschau, mit Transporten aus dem jüdischen Ghetto Łódź oder ab Ende 1944 mit Judentransporten aus Ungarn und der Slowakei, nachdem diese Länder von Deutschland besetzt worden waren.
Verzweifelte Mütter
In Ravensbrück erhielt jedes Kind unabhängig vom Alter eine Häftlingsnummer und hatte sich an die Lagerordnung zu halten. Dies galt insbesondere für die obligatorische Anwesenheit bei den Zählappellen. Die älteren Kinder waren auch verpflichtet zu arbeiten, die jüngeren verbrachten die Tage allein in den Wohnbaracken oder trieben sich im Lager umher.
Elisabeth Sommer-Lefkovits war mit ihrem Sohn Ivan in einem ausschliesslich für Mütter mit Kindern vorgesehenen Block untergebracht. Die Situation dort beschreibt sie folgendermassen: «Wie viele Mütter und Kinder dort ihre Inhaftierung verbrachten, konnte man nicht wissen, weil täglich einige starben. Verzweifelt und hilflos mussten wir dem weinenden Flehen unserer sterbenden Kinder zuhören: ‹Mutti, ich bin hungrig, ich bin sehr hungrig!› ‹Mamili, bitte, bitte, gib mir Wasser!›».
Die fürsorgliche Elisabeth versuchte, ihren Sohn im Rahmen des Möglichen vor den Fallstricken des Lagerlebens zu bewahren, was jedoch kaum möglich war. Sie meldete sich freiwillig zum Dienst im Aussenkommando, wofür sie höhere Lebensmittelrationen erhielt, kehrte aber oft erst nach Einbruch der Dunkelheit in die Unterkunft zurück und konnte so ihren Sohn nicht im Auge behalten. Sie verbot ihm deshalb strengstens, den Block zu verlassen, und um keinen Preis durfte er Kontakt mit den anderen Kindern aufnehmen, da sie auch diese als Gefahr ansah.
Die schwierigste Zeit in Ravensbrück erlebte sie, als ihr Sohn an einer Mittelohrentzündung erkrankte. Die Lagerärztin konnte ihm nicht einmal Medikamente gegen die Schmerzen besorgen. Die verzweifelte Mutter musste sich von ihr die Feststellung anhören, dass dem Kind die Gefahr einer beiderseitigen Taubheit drohe, weshalb es besser wäre, wenn es stürbe.
Kinder, die um Essen bettelten, waren ein häufiger Anblick in Ravensbrück. Sie versuchten, durch Tanzen die Aufmerksamkeit der erwachsenen weiblichen Häftlinge zu gewinnen. Einigen Erinnerungen zufolge wurden die Kinder direkt durch ihre Mütter zum Betteln ermutigt, die hofften, dadurch auch sich selbst besser versorgen zu können. Die Anwesenheit von Kindern im Konzentrationslager liess kaum einen der weiblichen Häftlinge kalt und viele waren durch sie emotional sehr berührt. Mitleid mit ihnen war eine natürliche Reaktion und die herumstreunenden Bettelkinder erhielten oft etwas geschenkt.
Solidarität unter den Häftlingen
Den aus politischen Gründen inhaftierten Frauen aus Tschechien blieben in diesem Zusammenhang vor allem die «Zigeunerkinder» in Erinnerung, die nach der Liquidation des «Zigeunerlagers» von Auschwitz-Birkenau 1944 nach Ravensbrück kamen. Die Kinder konnten jedoch auch auf ablehnende Reaktionen stossen: «Manchmal trafen wir Leute, die Pakete bekommen hatten, welche vom Roten Kreuz eingetroffen waren. Wir beguckten sie neidisch und sie versteckten schnell deren Inhalt, denn sie fühlten sich unter unseren Blicken unwohl», erinnert sich Sigmund Baumöhl, welcher als Kind zusammen mit seiner Mutter nach Ravensbrück deportiert wurde.
Die weiblichen Gefangenen organisierten untereinander zur Unterstützung ihrer Kinder verschiedene Sammlungen von Kleidung und Schuhen. Erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang der Versuch der Kommunistinnen, die Situation der Kinder im Lager systematisch zu verbessern. Sie bauten nach und nach ein recht umfangreiches nationalitätenübergreifendes Netzwerk illegaler Beziehungen auf, das sich auf verschiedene illegale Tätigkeiten und politische Agitationen unter den weiblichen Mitgefangenen konzentrierte. Angesichts der stetig steigenden Zahl von inhaftierten Kindern gründeten die Mitglieder des verbotenen internationalen kommunistischen Komitees im Mai 1944 einen Kinderausschuss, der die Situation der Kinder (insbesondere der Zigeunerkinder) verbessern sollte. Manche Mütter aber tauschten geschenkte Kleidung und Schuhe gegen Essen und diese Kinder liefen weiter in zerlumpten Sachen und barfuss umher. Der besagte Ausschuss sollte über Aufseherinnen unter den Häftlingen auch auf die deutsche Lagerleitung Einfluss nehmen, damit für die Kinder ein eigener Unterkunftsblock eingerichtet werde. Nach und nach konnten der SS-Lagerarzt und die Oberaufseherin für diese Idee gewonnen werden und anschliessend begann man mit der Errichtung des Kinderblocks.