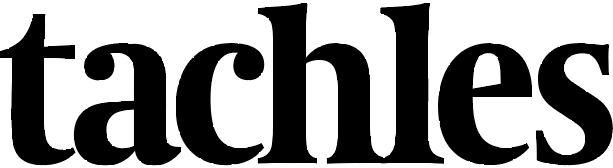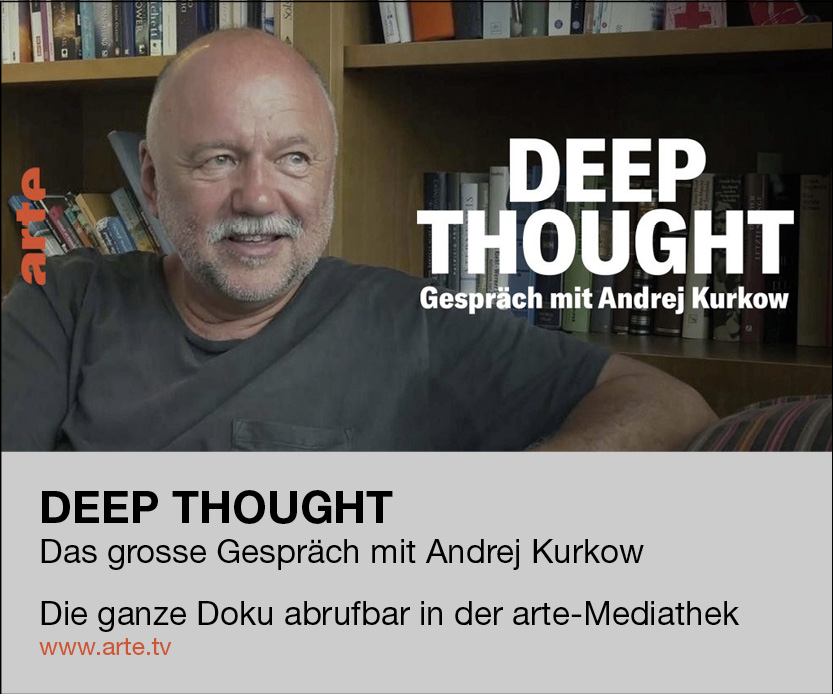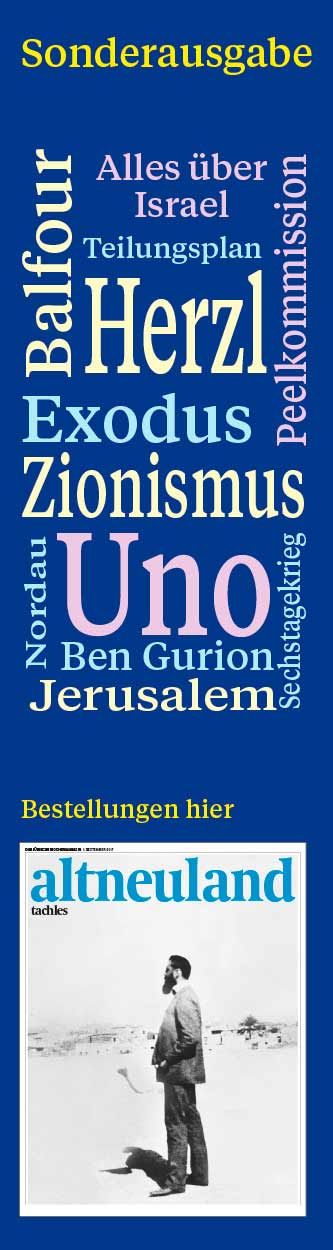Wannseee, April 2025. Da liegt sie im Antiquariat inmitten von Berlin. Die alte Haggada, deutscher Provenienz. «Da kam der Todesengel und schlachtete den Schlächter / der den Ochsen getötet hat / der das Wässerchen getrunken hat / das das Feuerchen gelöscht hat, / das das Stöckchen verbrannt hat / das das Hündchen schlug, / der die Katze biss, / die das Lämmchen frass / das mein Vater für zwei Münzen gekauft hat.» Der aramäische Kettenreim «Chad Gadya» zum Ende der Pessach-Haggada über ein Zicklein ist wohl der geheimnisvollste Text in der Textsammlung. Er kam als letzter dazu, fand daher von vielen klassischen Exegeten keine Beachtung und wurde später mitunter als Konklusion jüdischer Geschichte durch die Jahrhunderte gelesen. Eine Allegorie auf die Geschichte des jüdischen Volkes. In der Schlussstrophe wird der Todesengel erschlagen. Wer das wohl sein mag in der Gegenwart. – Liturgie, Literatur, Kultur trägt durch die Zeit, durch Jahrhunderte und relativiert die Gegenwart im Kontext eines historischen Bewusstseins. Realitäten ertragen oder verkennen? Pessach 5786 steht im Kontext der israelischen Geiseln in der Gewalt der Hamas. Es ist der grösste Skandal in der jüdischen Gegenwart. Zivilisten in der Gewalt von Terroristen unter den Augen der zuschauenden Weltöffentlichkeit – und der israelischen Regierung. Es ist ein Masada, ein langes, leidvolles Sterben auf Raten. Kein erzwungener Suizid, sondern Barbarismus. – Der Zählreim «Chad Gadya» spiegelt in seiner Vielschichtigkeit die kulturellen Einflüsse aus Ost und West und wurde in vielen jüdischen Traditionen musikalisch und künstlerisch neu interpretiert. Als Sinnbild für Gewaltzyklen, Hoffnung und Gerechtigkeit bleibt es offen für neue Deutungen. Die Mischung aus Aramäisch, Reimform und Symbolik zeigt die Vielfalt jüdischer Herkunft. Der Text verbindet Generationen über Sprache, Kunst und Geschichte hinweg und ist oft in den jeweiligen Sprachen der jüdischen Gemeinschaften in der Zeit übersetzt und neu intoniert worden – in Jiddisch, Ladino, Tunesisch, Marokkanisch, Arabisch-Jüdisch, Hebräisch und so fort. Das Institut européen de musique juive vereint eine grosse Sammlung historischer Aufnahmen, die es sich vor jedem Seder anzuhören lohnt und die nochmals vor Augen führt, wie jüdische Gemeinschaften Kultur integriert haben. Der verstorbene englische Oberrabbiner Jonathan Sacks interpretierte den Text als zerstörerischen Zyklus von Vergeltung und Gewalt. In dieser Deutung symbolisiert das junge Zicklein das Volk Israel, und die nachfolgenden Figuren repräsentieren aufeinanderfolgende Imperien oder Nationen, die Israel im Laufe der Geschichte unterdrückt haben. Der abschliessende Eingriff Gottes steht bei Sacks für das Ende dieses Kreislaufs. Er betont, dass das Lied trotz seiner scheinbaren Einfachheit eine tiefgehende Botschaft der Hoffnung vermittelt. Übersetzt mag da der französische Philosoph Emmanuel Levinas die wahre Interpretation des Textes in «Ethik und Unendliches» für die heutige Zeit auf den Punkt gebracht haben: «Die Ethik ist nicht eine Theorie der Gewalt, sondern ihre Unterbrechung.» Wo liest sich das besser als in der Gedenkstätte Wannsee an diesem Tag (vgl. Seite 34). Dort, wo in der idyllischen Villa am 20. Januar 1942 unter Vorsitz von NS-Funktionär Reinhard Heydrich die «Endlösung der Judenfrage», die systematische Vernichtung der europäischen Juden, beschlossen wurde und der Todesteufel die NS-Uniform trug. Das Primat «Nächstes Jahr in Jerusalem» in der Pessach-Haggada war nie eines für Juden ausserhalb Israels, nicht Teil eines politischen Programms oder einer Ideologie. Es ist und bleibt der Ruf nach Freiheit für die Gefangenen – und nun zum dritten Mal für die israelischen Geiseln.
Yves Kugelmann ist Chefredaktor der JM Jüdischen Medien AG.
das jüdische logbuch
11. Apr 2025
Ein «Chad Gadya» für Geiseln
Yves Kugelmann