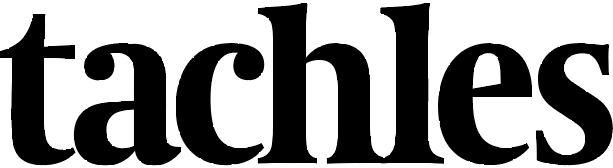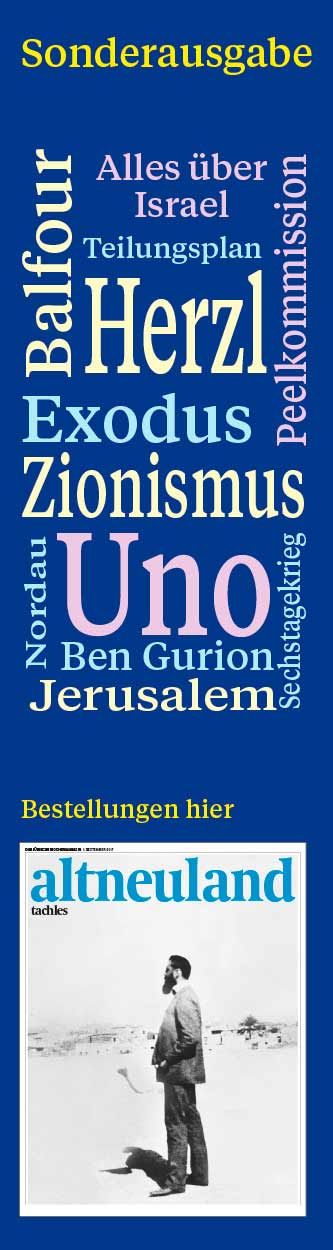Erklärung von Bürgermeisterin Femke Halsema.
Achtzig Jahre nach der Befreiung der Niederlande durch alliierte Truppen am Ende des Zweiten Weltkriegs hat sich die Amsterdamer Bürgermeisterin Femke Halsema am Donnerstag für die Rolle der Stadt bei der Verfolgung ihrer jüdischen Einwohner während des Holocaust entschuldigt. Die Gemeinde und ihre Regierung habe moralisch kollektiv versagt: «Die Amsterdamer Regierung war, als es darauf ankam, weder heldenhaft noch entschlossen noch barmherzig. Und sie hat ihre jüdischen Einwohner auf grausame Weise im Stich gelassen.»
Halsema hat die Entschuldigung in einer Rede anlässlich einer Holocaust-Gedenkfeier in der Hollandsche Schouwburg ausgesprochen, einem Theater, das die Nazis zu einem Deportationszentrum für Amsterdamer Juden in Konzentrationslager in den Niederlanden und anderen Teilen Europas umfunktioniert hatten. Bis zum deutschen Einmarsch lebten 80.000 jüdische Menschen in Amsterdam. Die Nazis deportierten und töteten mit Unterstützung lokaler Behörden mehr als 60.000 von ihnen: «Verwaltung und Beamte waren nicht nur kalt und formalistisch, sondern sogar bereit, mit den Besatzern zu kooperieren», so Halsema: «Das war ein unverzichtbarer Schritt zur Isolation, Demütigung, Deportation, Entmenschlichung und Ermordung von 60'000 Amsterdamer Juden.»
Die Stadtverwaltung arbeitete auf mehreren Ebenen mit den Nazis zusammen; städtische Beamte kartierten die Wohnorte jüdischer Menschen, und örtliche Polizisten halfen bei der Deportation ihrer Mitbürger. Halsema hielt fest, auch in den Niederlanden habe es vor – und nach – dem deutschen Einmarsch Antisemitismus gegeben: «Es gab schon immer Hass gegen Juden – auch in dieser Stadt – und er existiert immer noch.» Die Stadt will laut der Bürgermeisterin 25 Millionen Euro investieren, um jüdisches Leben und die Sichtbarkeit des Judentums in der Stadt zu fördern. Ein neuer sechsköpfiger Ausschuss wird über die Verwendung dieser Mittel entscheiden.
Laut der «New York Times» sind die Rede und die Initiative überraschend und werden bei der jüdischen Gemeinde positiv aufgenommen: «Damit hatte ich nicht gerechnet», erklärte dazu etwa die jüdische Stadträtin Keren Hirsch: «Man kann die Zeit nicht zurückdrehen, man kann das, was die Stadt getan hat, nicht ungeschehen machen. Aber diese Entschuldigung, diese Worte, sind mir wichtig» (Link).